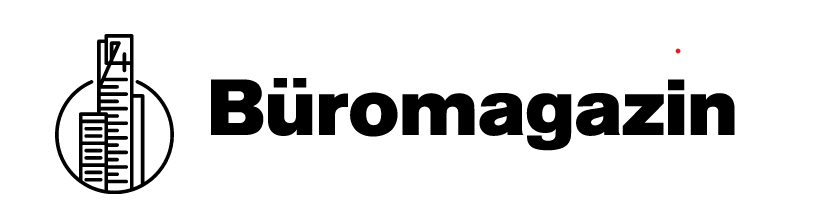KfW Research prognostiziert für das Jahr 2023 eine Wachstumsrate des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von -0,3 % und für 2024 eine Rate von 1,0 %. Die Inflationsrate in Deutschland wird 2023 bei 6,3 % und 2024 bei 2,4 % erwartet. Der Treibhausgasausstoß wird 2023 um 5 % und 2024 um 6 % über dem angestrebten Zielpfad liegen.
Erholung der Wirtschaft
Nach einer technischen Rezession im Winterhalbjahr wird die Wirtschaft ab dem zweiten Quartal 2023 auf einen flachen Wachstumspfad einschwenken. Vor allem Nachholeffekte bei der Industrieproduktion und Zuwächse bei unternehmensnahen Dienstleistern werden die Erholung antreiben, bevor eine moderate Erholung des privaten Konsums mit positiven Effekten für konsumnahe Dienstleistungsbereiche hinzukommt.
Stagnation des BIP
Für das Gesamtjahr 2023 erwartet KfW Research mit -0,3 % praktisch eine Stagnation des BIP gegenüber dem Vorjahr, da 0,2 Prozentpunkte dieses Rückgangs allein auf die geringere Anzahl an Arbeitstagen im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen sind (Kalendereffekt). Im Jahr 2024 dürfte die Wirtschaftsleistung um 1,0 % zulegen.
Konjunkturerholung mit angezogener Handbremse
„Deutschland erlebt eine Konjunkturerholung mit angezogener Handbremse“, sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. „Nachlassende Angebotsschocks und anziehendes Lohnwachstum stützen die Konjunktur, während die Geldpolitik angesichts des breiten Inflationsdrucks weiter bremst. Unterm Strich dürfte im Jahr 2023 praktisch eine Stagnation der Wirtschaftsleistung stehen, für 2024 erwarte ich ein Wachstum von rund 1 %.“
Positive Faktoren für die Wirtschaft
Material- und Lieferengpässe haben sich weltweit deutlich entspannt und schränken mit etwas Verspätung auch die Produktion der Unternehmen in Deutschland immer weniger ein. Die aktuellen Energiepreise im Großhandel, insbesondere für Erdgas, wirken konjunkturstützend, da sie inzwischen deutlich unter den Werten von 2022 liegen. Die Produktion in ehemals materialbeschränkten Branchen wie dem Autobau expandiert kräftig und auch die Produktion in den besonders energieintensiven Bereichen wie der Grundstoffchemie erholt sich seit dem Jahreswechsel. Das anziehende Lohnwachstum stabilisiert den privaten Konsum im Jahresverlauf.
Geldpolitik als Gegenfaktor
Gegenläufige Wirkungen für die Konjunktur kommen von der Geldpolitik. Obwohl die Europäische Zentralbank in diesem Sommer den Hochpunkt ihres Zinszyklus erreichen dürfte, nimmt die konjunkturelle Bremswirkung der 2022 begonnenen geldpolitischen Straffung im Euroraum noch zu.